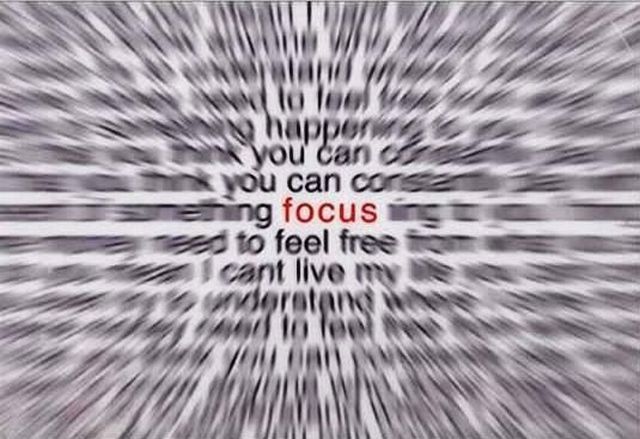Nach einiger Wartezeit geht Facebooks Timeline-Rollout jetzt tatsächlich mal los: Die neue Profilseite, die das Leben als Chronik quasi von der Wiege bis zur Bahre darstellen kann, startet erstmal nur in
Neuseeland - quasi der isolierte Insel-Testmarkt.
Heißt auch: Der Schraub- und Justierbedarf am System wie auch in Sachen Social Engineering (wie kriege ich meine Nutzer dazu, es zu verwenden und nicht durchzudrehen) ist wohl größer als im September gedacht.
Medienangebote schielen in die Richtung der Timeline, weil sie mit dem veränderten Open Graph zusammenhängt. Genauer gesagt mit der Möglichkeit, über Facebook-Apps die Freunde der eigenen Nutzer wissen zu lassen, was diese gerade lesen oder ansehen.
Was das bringen soll? Naja: Wie wäre es mit einer Million Page Impressions pro Tag? Die verzeichnet nämlich der Guardian über seine App, wie
Facebook fröhlich verkündet.
Vier Millionen Nutzer haben die App installiert - die Hälfte davon unter 24 Jahren. Was ein Hinweis, aber keine harte Zahl dazu ist, wieviele dieser Nutzer tatsächlich neu zum Guardian gestoßen sind und wie viele nur ihre Nutzung erhöht oder verlagert haben. Trotzdem: Beeindruckende Zahl. Und eine, die konkrete Leistungswerte bietet, auch wenn es um das Thema Monetarisierung geht.
Wie auch die 3,5 Millionen monatlicher User der Washington Post oder die Million des Independent. Yahoo spricht von einer Traffic-Erhöhung via Facebook um 600 Prozent durch die zehn Millionen, die die App verwenden. Nebenbei bemerkt: In der Reihe prominenter Startpartner, die jetzt positive Zahlen vermelden, fehlt News Corps. The Daily. Nur mal so in den Raum gestellt.
Das heißt: Apps, um den Nutzern via frictionless sharing noch direkter nicht nur Zugang zu eigenen Inhalten zu bieten, sondern das auch noch deren Freunden auf die Nase zu binden, können für einen weiteren Traffic-Schub sorgen. Schon jetzt sind Social Networks für
28% eine Nachrichtenquelle - selbst im datenschutzsensitiven Deutschland. Dass der Social Graph (das eigene Netzwerk aus Freunden und Bekannten) einen relevanten Zugangskanal zu Informationen darstellt, dürften die meisten auch aus eigener Erfahrung kennen. Ein neues Phänomen ist es ohnehin nicht. Sondern nur die Verlagerung dessen, was früher als Gespräch in der Teeküche oder dem Schulhof galt.
Der Donnerstag vorgestellte Subscribe Button für externe Websites geht im übrigen in die gleiche Richtung, auch wenn er erst mal nur die jeweiligen Abonnenten bespielt und nicht deren Freunde.
Wird das ganze bruchlos - was nichts anderes heißt, als dass es keine explizite Aktion des Nutzers braucht, sondern sein Verhalten automatisch mitgeteilt wird - kann das für einen Schub sorgen. Es muss nicht, weil es auch zu einer Überflutung mit Informationen führen kann. Denn Stand jetzt profitieren die Anbieter mit den positiven Zahlen von einer überschaubaren Zahl an Wettbewerbern. Und natürlich müssen die Nutzer die Funktion annehmen und aktivieren. Was in Teilen der Grund für den langsamen Rollout sein dürfte. Aber es kann die Bedeutung von Facebook als Traffictreiber weiter erhöhen. Und das ist, gerade wenn man sich die Verschiebungen bei den Zugangswegen zu Informationen im Netz ansieht, durchaus ein Thema, das man im Auge behalten sollte.