Im Anschluss an die Gefahr der reinen
Reichweitenjagd und eine Betrachtung von Paid Content geht es in Teil
3 um den Wert der eigenen Rolle und eigenen Stimme. Denn, wie schon
in den vorigen Texten angerissen, kann Austauschbarkeit nicht das
Ziel von Medien sein, ist sogar eine der größten Gefahren.
Wer laut jammert, dass es ja allgemeine
Inhalte auch anderswo im Netz zuhauf gäbe, übersieht die darin
liegende Chance: Ich muss nichts ausführlich machen, was meine Leser
an x anderen Stellen genauso finden können. Die Ressourcen dafür
kann ich mir sparen. In der gerade durch die Digitalisierung
bedingten Informationsvielfalt sind einzelne Medientitel erst recht
nur eine von vielen Stimmen, aus deren Chor der einzelne Nutzer seine
Informationen bezieht.
Das mag einigen höchst unwillkommen
sein und Angst machen, eröffnet aber auch Chancen. So Verlage sich
vom alten Leitbild "Leser, du sollst keine anderen Medien neben mir
haben!" lösen und die Pluralität nicht nur anerkennen, sondern
für sich nutzen.
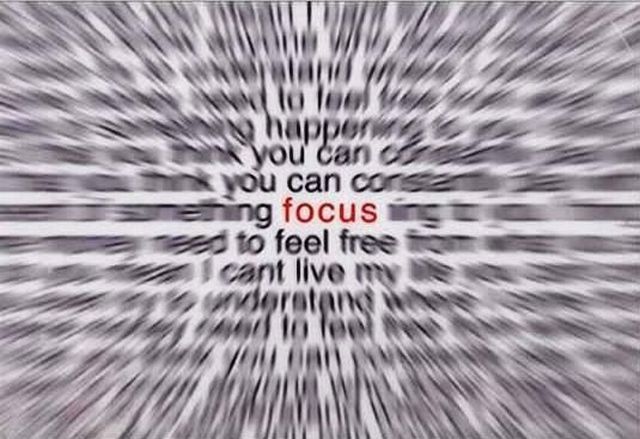 |
| Die eigene Stimme fokussieren - auf das, was man zum Gesamtklang beitragen kann. Bild: AllthingsD. |
Die Vernetzungsmöglichkeit stellt –
so lapidar das nun klingen mag – ein ganz zentrales Merkmal des
Netzes dar. Die Weigerung mancher Medien, auf andere Quellen –
entweder Mediensites oder Blogs, Homepages, was auch immer, zu
verlinken, stammt aus dem ursprünglichen Alleinvertretungsanspruch und dem
Bestreben, möglichst viel Traffic zu horten. Auf andere verweisen
wäre aber ein Gedanke, der viel organischer zur Netznatur passen würde -
und natürlich Teil des journalistischen Auftrages oder Schaffens darstellt.
Die Auswahl und Präsentation von Themen gehört fest zu
diesem Beruf. Auf andere verweisen und verlinken, allgemeines in
Kürze, auch via dpa, präsentieren, Aggregationsbereiche und
Klicktipps anbieten, das passt da alles hinein - als Service. Andere da aufgreifen, wo es sinnvoll und absolut ausreichend ist. Man muss nicht alles selbst machen, gerade dann, wenn es eigentlich nichts eigenes beizutragen gibt.
Wir sind nicht aber "nur"
Kuratoren.
Wir sind auch Stimmen, die aufmerksam
machen, unterhalten, analysieren und einordnen sollen. Auch das bringen, das sich nicht überall, sondern vielleicht kaum findet. Kurz: etwas
eigenes beitragen.
Denn wenn man sich der Wahrheit stellt,
dass das eigene Medium nur eine Stimme im Konzert ist, wird auch
klar: Das Schärfen, die Ausbildung dieser Stimme ist für den Erfolg ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, dass die
Redaktion eine klare, wiedererkennbare Tonlage und Haltung an den Tag
legen muss.
Das wäre an und für sich nichts Neues - redaktionelle Linien, Tendenzen und Tonalitäten gehören
eigentlich dazu, sind auch das, wodurch Medienmarken sich definieren. Wenn dann aber - wie im Fall der Frankfurter
Rundschau schon in den 90ern - als Ansage festgelegt wird, dass man keine "Edelfedern" haben
wolle, keine Köpfe und wiedererkennbaren Stimmen, dann geht diese
Chance, Austauschbarkeit zu verhindern, verloren. Journalismus lässt
sich nicht maschinell konfektionieren. (Texte innerhalb gewisser Grenzen
schon, aber Journalismus nicht.) Im Fall der Frankfurter Rundschau ist das Ergebnis bekannt - ein Niedergang, der letztendlich zur Insolvenz führte.
Die Stimme eines Mediums prägen die
Menschen, die zusammen dieses Medium erstellen (nicht nur die
schreibende Redaktion, um das klar festzuhalten.) In gewissen Teilen
und Rahmen lassen sich Markenidentitäten schaffen, redaktionelle
Linien und Eigenarten vorgeben. Aber die jeweils dahinter direkt
beteiligten Menschen sind nicht folgen- und problemlos austauschbar.
Wenn sie es sind, dann ist der Titel
schon so beliebig geworden, dass er keine langfristige Zukunft hat.
Der Wert von Stimmen im Netz
Auch wer im Netz gehört werden will, sollte
eine eigene Stimme, Tonalität, Haltung haben. Man kann auch insofern
Inhalte bieten, die kein anderer hat, dass es eben der eigene Take zu
einem Thema ist. Von einer Medienmarke oder einem Autoren, den die
Nutzer schätzen und der/dem sie vertrauen. Vertrauen stellt dabei
etwas dar, dass man sich verdienen muss. Und dem es anschließend
gerecht zu werden gilt.
Dieses Vertrauen kann an klassischen
Medienmarken hängen bei den Zielgruppen, für die diese positiv
aufgeladen sind. Bei anderen Zielgruppen muss es erarbeitet werden.
Durch gute Texte, gute Inhalte.
Das ist ja der Witz an Viralität: Es
sind einzelne Inhalte, die sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Es ist
der einzelne Text, der geteilt wird, der einzelnen Sites, Blogs,
Präsenzen auf einmal Traffic entgegen spült. Aufgrund des
Vertrauens nicht in die Inhaltequelle, sondern in den Kontakt, der
diesen Inhalt geteilt hat. Aus Gelegenheitsbesuchern können aber –
so man sie überzeugt – häufigere Gäste werden. Das setzt voraus,
dass sie genug gutes finden, das sie auch interessiert.
Vertrauen kann auch an konkreten
Autoren hängen, deren Arbeit quasi eine Gruppe von Stammlesern
bindet. Vorteilhaft dürften Kombinationen dessen sein. (Das heißt
übrigens nicht, dass die Leser dem konkreten Autoren grundsätzlich
in allem zustimmen. Es heißt nur, dass ihnen dessen Texte und
Meinungen die Auseinandersetzung damit wert sind.) Dafür muss es
diese Autoren nur geben, und sie müssen den Freiraum haben, so
arbeiten zu können, dass sie und ihr Medium wiedererkennbar sind,
auch ohne Logo und Byline.
Was das helfen könnte? Nun, es greift einen Teil der von Kritikern
vorgebrachten "existenziellen Probleme" der Medien auf: Michael Wolff nennt im Guardian-Stück This tipping-point for paywalls does not fix newspapers' larger crisis (dessen Schwarz-Weiß-Einstellung ich im Übrigen nicht teile) als eines
der Kernprobleme:
An extraordinary indifference, if not utter lack of interest, on the part of younger people to news brands and to news habits, a development that established news organizations have been unable to address, stall, or even fathom.
Es geht darum, auch neuen Zielgruppen zu zeigen, dass man ihre Zeit wert ist. Die Strahlkraft etablierter Marken wirkt bei diesen nicht zwangsläufig. "Ich schreibe für Qualitätsmedium X, ich habe recht" stellt für sie kein Argument dar. (Ohnehin ist der Markenverweis nur eine Heuristik. Eine Heuristik, deren Wahrheitsgehalt man ständig beweisen muss.) Es geht darum, sich als eine der Stimmen im Informationschor Gehör zu verschaffen, etwas zu liefern, das Aufmerksamkeit weckt und dazu führt, dass sich Menschen die Zeit nehmen, zuzuhören. Das bedeutet auch, dass man sie ernst nehmen muss. Denn wenn die neuen Leser Marken nicht vertrauen, dann vielleicht Menschen. Und mit der Zeit den Marken, für die diese stehen. (Stehen, nicht einfach nur arbeiten.) Denn informieren oder unterhalten werden wollen Menschen nach wie vor. Sie haben nur mehr Möglichkeiten, nutzen auch andere Quellen. Also beginnt - zumindest in Teilen - der Prozess erneut, sich in ihr relevant set zu arbeiten. Oder jenseits der Marketing-Vokabeln: Eine der Stimmen zu sein, die sie wahrnehmen und der sie zuhören, Zeit schenken.
Überdehnten Stimmen fehlt Ausdruckskraft
Generell heißt das: Weniger
Beliebigkeit, mehr Eigennote. Und das stellt gerade die große Gefahr
dar: Je dünner die Ressourcendecke wird, je mehr man sich nach
Reichweite streckt und möglichst viel machen will, umso eher klingt
diese Eigennote immer dünner und geht verloren.
Note bedeutet dabei für mich nicht nur
Tonalität, auch Haltung und Expertise. (Es geht also beileibe nicht darum, die ganze Zeit Meinung zu äußern, falls jemand glaubt, dass ich davon reden würde.) Kleines, halbwegs aktuelles
Beispiel: Vergangene Woche hat Facebook sein neues Mobilprodukt Home
vorgestellt. Und bei der puren Zahl von Artikeln – online wie Print
– die mir austauschbar Zuckerbergs Sätze aus der Präsentation
nachgebetet haben (Mit eigenem Handy hätte Facebook ja nur zehn,
zwanzig Millionen erreicht; Menschen in den Mittelpunkt stellen,
nicht Apps) ohne das zu zerpflücken oder zumindest vernünftig
einzuordnen, hat mich entsetzt. Das akzeptiere ich höchstens bei
denen, die mir unbedingt gleich während des Events einen Überblick
geben wollen. Bei allem anderen ist mir in der Rolle des Lesers völlig schnurz, ob derjenige
der erste ist, der mir einen Text anbietet. Ich will nicht ein Dutzend
schlechte Artikel lesen müssen, um ein Bild aus Fragmenten zusammenzusetzen.
Ich will ein paar wenige, dafür umfassende, gute lesen.
Ich habe die Zeit, auf einen guten
Artikel zu warten. Ich habe nicht die Zeit, ein dutzend schlechte zu
lesen.
Gute Artikel setzen aber im allgemeinen
voraus, dass es gute Redaktionsmitarbeiter gibt und diese die Zeit
für gute Texte haben. Deswegen ist das Vorgehen vieler Medienhäuser
so irrwitzig: Sie gehen mit der Axt an die Ressourcenlage.
Verkleinern Redaktionen, kaufen Inhalte irgendwo billig zu, versuchen
aus weniger Leuten das gleiche, wenn nicht mehr an Output
rauszuquetschen. Weil sie Output quantitativ messen, nicht
qualitativ.
Daraus folgen dann die in Teil 2
erwähnten 31 Prozent der Befragten einer PEW-Studie, die einem
Medientitel den Rücken gekehrt haben, weil er nicht länger das
bietet, was sie erwarten. Und die Spirale dreht sich weiter nach
unten.
Vor einer Weile hat der Ex-Chefredaktor
von 20 Minuten Online, Hansi Voigt, dazu in einem sehr lesenswerten
Interview bei der Schweiz am Sonntag folgende interessante Passage geliefert:
"Aus der Sicht des Kosten-Controllings sind Journalisten nicht mehr als ein Kostenfaktor. Und sie sind inmitten von Fixkosten wie der Druckerei oder dem Vertrieb der variable Teil. Also spart man hier. Zumal gute Inhalte, die den journalistischen Markenwert steigern, für das Controlling nicht messbar sind und in keiner Jahresrechnung auftauchen."
Im Fall der Funke-Mediengruppe (vormals
WAZ) heißt das dann etwa, dass man mal eben 200 Leute entlässt und
glaubt, ohne die gehe das auch, man mache halt weniger hochtrabenden
Qualitätsjournalismus und dafür mehr lokalen Nutzwert.
Dabei sollten in Redaktionen nicht
weniger sitzen, die die gleiche Arbeit machen. Das ist
dünnintelligente, weil nur oberflächlich und kurzfristig ansetzende
Erbsenzählerei. Stattdessen sollten Redaktionen, sollten Medien
weniger machen – das aber besser.
Sparen? Mag nicht anders gehen. Aber
dann fokussiert Produkte, statt bloß Teams zu schrumpfen. Das bedeutet
Besinnung auf das, was man wirklich leisten und als Eigenleistung
bringen kann, was man zum vielstimmigen Informations- und
Medienkonzert beitragen kann. (Auch um daraus hervorzustechen.)
Macht weniger, aber das besser.
Was Medienmanager nach wie vor scheuen
wie der Teufel das Weihwasser, das sind Kürzungen am Objekt statt an der
Mannzahl. Printumfänge etwa werden nur unter Schmerzen und Zwang
reduziert.
Dabei ist das Unsinn. Der Leser ist für
seine vollumfängliche Information nicht auf einzelne Titel
angewiesen, das entspricht auch nicht seiner Nutzungsrealität. Auch
das Publikum sieht sich einer Informationsflut gegenüber. Genauso,
wie in Bookmark-Archiven und Accounts zig ungelesene Texte
schlummern, nehmen Leser nur einen Teil ihrer Medien, auch der
Printmedien, tatsächlich nachhaltig in Anspruch.
Wenn ich aber ohnehin x Prozent meiner
Zeitung oder Zeitschrift nicht lese, dann stört es mich auch nicht,
wenn sie dünner ausfällt. Im ersten Moment mag die Haptik kurz
stutzig machen. Aber jenseits dessen "fehlt" dem Leser nichts. Ob
ich 20 Geschichten nicht lese oder 15, das spielt keine Rolle. Was
dagegen eine Rolle spielt, ist die Qualität der Texte, die ich lese.
Immer weiter ausgedünnte Redaktionen
überdehnen sich aber, wenn sie die gleiche Fläche füllen sollen.
Dann werden auch die Texte flacher. Drei Seiten weniger, die ich eh
nicht lesen würde, stören mich nicht. Schlechte Texte,
Schreibfehler, auch Sachfehler, die aus Überlastung herrühren, die
schon. Dann fragt sich der Leser auch, warum er dafür zahlen soll.
Für Online-Medien gilt das analog.
(Und kommt mir jetzt nicht mit dem
damit verloren gehenden Anzeigenplatz. Wenn der über entsprechend
hochpreisige Schaltungen ausgebucht wäre, würden wir überhaupt
nicht über die Zukunft der Medien diskutieren, nicht wahr?)
Was heißt das nun, im Ergebnis?
Medien sollten das bieten, worin sie gut sind. Auf Inhalter anderer verweisen, wo das ausreichend ist. Das können natürlich auch Agenturinhalte sein - die sollten aber nicht kommentarlos unter eigenen Beiträgen gelistet werden. Denn die Stimme des Mediums verkörpern sie nicht. Diese müssen Medien stärker wieder bieten. Eine Stimme, die tatsächlich eigenes beiträgt – und Gründe
liefert, ihr zuzuhören.
Wir sind nur einer von vielen, aus dem
das Ganze entsteht. Umso wichtiger ist es, genau unseren Teil zu
diesem Ganzen beizutragen. Den Rest können die anderen machen.
Gedanken zur Zukunft der Medien,Teil 1: Die Überdehnungsgefahr durch die Reichweitenjagd
Gedanken zur Zukunft der Medien,Teil 1: Die Überdehnungsgefahr durch die Reichweitenjagd
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen