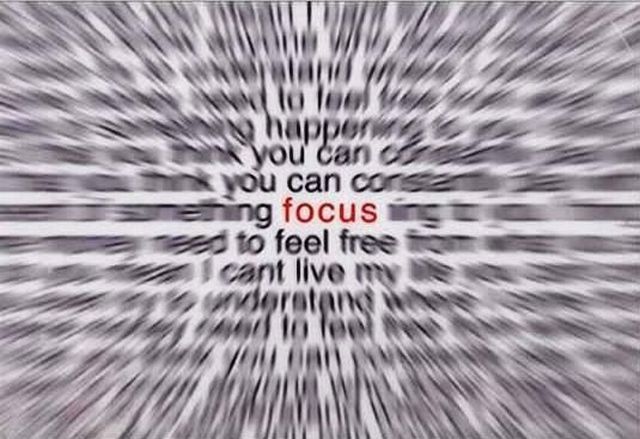Im Anschluss an die Gefahr der reinen
Reichweitenjagd und eine Betrachtung von Paid Content geht es in Teil
3 um den Wert der eigenen Rolle und eigenen Stimme. Denn, wie schon
in den vorigen Texten angerissen, kann Austauschbarkeit nicht das
Ziel von Medien sein, ist sogar eine der größten Gefahren.
Wer laut jammert, dass es ja allgemeine
Inhalte auch anderswo im Netz zuhauf gäbe, übersieht die darin
liegende Chance: Ich muss nichts ausführlich machen, was meine Leser
an x anderen Stellen genauso finden können. Die Ressourcen dafür
kann ich mir sparen. In der gerade durch die Digitalisierung
bedingten Informationsvielfalt sind einzelne Medientitel erst recht
nur eine von vielen Stimmen, aus deren Chor der einzelne Nutzer seine
Informationen bezieht.
Das mag einigen höchst unwillkommen
sein und Angst machen, eröffnet aber auch Chancen. So Verlage sich
vom alten Leitbild "Leser, du sollst keine anderen Medien neben mir
haben!" lösen und die Pluralität nicht nur anerkennen, sondern
für sich nutzen.
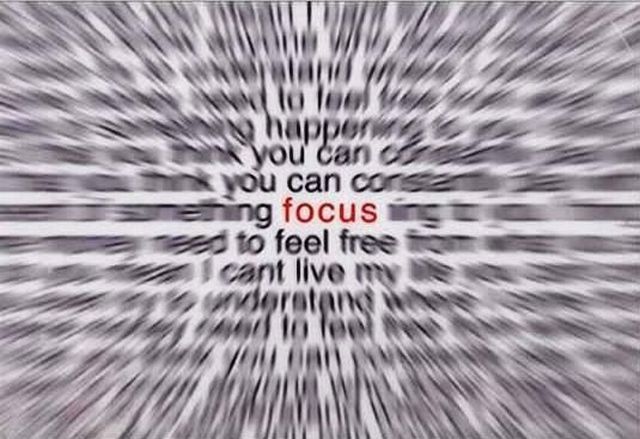 |
| Die eigene Stimme fokussieren - auf das, was man zum Gesamtklang beitragen kann. Bild: AllthingsD. |
Die Vernetzungsmöglichkeit stellt –
so lapidar das nun klingen mag – ein ganz zentrales Merkmal des
Netzes dar. Die Weigerung mancher Medien, auf andere Quellen –
entweder Mediensites oder Blogs, Homepages, was auch immer, zu
verlinken, stammt aus dem ursprünglichen Alleinvertretungsanspruch und dem
Bestreben, möglichst viel Traffic zu horten. Auf andere verweisen
wäre aber ein Gedanke, der viel organischer zur Netznatur passen würde -
und natürlich Teil des journalistischen Auftrages oder Schaffens darstellt.
Die Auswahl und Präsentation von Themen gehört fest zu
diesem Beruf. Auf andere verweisen und verlinken, allgemeines in
Kürze, auch via dpa, präsentieren, Aggregationsbereiche und
Klicktipps anbieten, das passt da alles hinein - als Service. Andere da aufgreifen, wo es sinnvoll und absolut ausreichend ist. Man muss nicht alles selbst machen, gerade dann, wenn es eigentlich nichts eigenes beizutragen gibt.
Wir sind nicht aber "nur"
Kuratoren.
Wir sind auch Stimmen, die aufmerksam
machen, unterhalten, analysieren und einordnen sollen. Auch das bringen, das sich nicht überall, sondern vielleicht kaum findet. Kurz: etwas
eigenes beitragen.
Denn wenn man sich der Wahrheit stellt,
dass das eigene Medium nur eine Stimme im Konzert ist, wird auch
klar: Das Schärfen, die Ausbildung dieser Stimme ist für den Erfolg ein ganz zentraler Punkt. Das heißt, dass die
Redaktion eine klare, wiedererkennbare Tonlage und Haltung an den Tag
legen muss.